Kirchen und Konfessionen
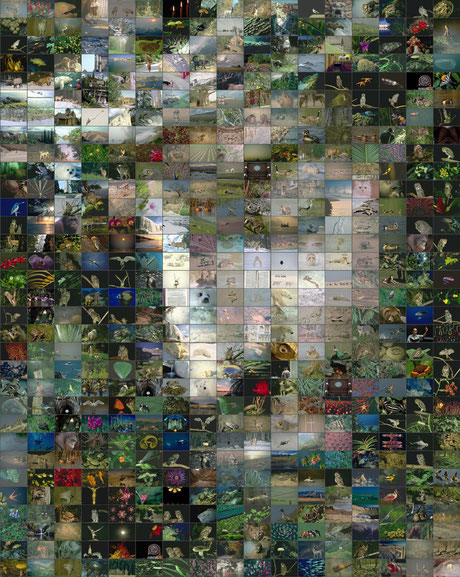
Christ sein mit und ohne Religion
Prof. emer. Dr. theol. Hans-Martin Barth, Universität Marburg
Überlegungen zum Dialog mit Konfessionslosen und Areligiösen
Dem christlichen Glauben gegenüber zeigen sich heute unterschiedliche Verhaltensmuster:
Ein erstes Verhaltensmuster zeigt sich an Menschen, die sich nach wie vor zur Kirche halten,
– existenziell verbunden, dogmatisch nicht verunsichert, oder sogar fundamentalistisch-charismatisch orientiert,
– noch verbunden, aber mit dem Gefühl, wesentliche Aussagen des christlichen Glaubens nicht mehr verstehen oder gar teilen zu können, oder
– zwar traditionell verbunden, aber ohne innere Beziehung (die Zielgruppen der Erwachsenenbildung). Über diese und weitere Differenzierungen kann man sich in den Mitgliedschaftsuntersuchungen der EKD [1] oder im Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung [2] informieren.
Einem zweiten Verhaltensmuster folgen Menschen, die sich dezidiert
– für Agnostiker
– oder Atheisten halten. Dazu lese man z. B. Franz M. Wuketits [3] oder Bernulf Kanitscheider [4].
Eine dritte Gruppe bilden Menschen, die religiös sind,
– aber zu den inhaltlichen Aussagen des Glaubens keine Beziehung haben, trotzdem vielleicht noch einer Kirche angehören, oder die
– die inhaltlichen Aussagen des Glaubens ablehnen und daher keiner Kirche (mehr) angehören. Beide Varianten können aber die kulturellen Angebote der Kirchen schätzen. Sie hat wohl Dietrich Stollberg mit seiner Identifikation von Religion und Kunst vor Augen. [5]
Viertens gibt es Menschen, die
– die Institution Kirche in Kauf nehmen, weil sie etwas vom christlichen Glauben festhalten wollen
(Ethos, protestantisch-säkulare Identität) oder aber
– die Institution Kirche ablehnen, sich jedoch gleichwohl für Christen halten. Hier wären Autoren wie z. B. der Journalist und vormalige Theologe Peter Rosien zu nennen, der sich für eine „religionsübergreifende Mystik“ ausspricht. [6] Sie stellen Theologie und Kirche vor die Frage: Kann man Christ sein außerhalb einer institutionalisierten Kirche?
Schließlich ist – fünftens – für eine wachsende Anzahl von Menschen die Religion und folglich auch christlicher Glaube überhaupt kein Thema (mehr). Ihnen gegenüber lautet die theologische Herausforderung: Kann man Christ sein ohne Religion?
Die folgenden Überlegungen haben vor allem die Gruppen 4 und 5 im Blick: die – tendenziell oder faktisch Konfession-slosen und die Areligiösen. [7] Ich wende mich nicht „missionarisch“ direkt an sie, sondern ich möchte diskutieren, ob
die Kirche das Evangelium bezeugen kann, ohne mit für Areligiöse unnachvollziehbaren religiösen Vorstellungen arbeiten und ohne auf der Zugehörigkeit zu einer (Institution) Kirche bestehen zu müssen. "Christus ohne Religion“ betitelt eine Zeitschrift ihre Rezension meines Buchs und trifft damit mein Anliegen. Noch deutlicher wäre wohl:
„Christsein ohne Religion“.
Deutschlandradio Kultur fragt kritisch: „Lässt ein konfessionsloses Christentum nicht die Gläubigen auf der Strecke, ohne den Nicht-Gläubigen mehr zu bieten als ‚substanzlos glücklich’ zu sein?“ Werde hier nicht das Unmögliche ver-sucht: „die Kirche einerseits den Gläubigen zu erhalten und sie andererseits für die Noch-Nicht-Gläubigen zu über-winden“?
Ich gehe von der Beobachtung aus, dass viele Menschen die Annahme einer jenseitigen Welt, in der und von der aus
ein „Gott“ oder andere „Akteure“ agieren, nicht teilen können. Kommt christlicher Glaube für sie damit nicht infrage?
Ich behaupte: Die Orientierung an der Jesus-Tradition im Leben und im Sterben ist auch für sie möglich und sinnvoll, zugleich für sie selbst und ihre Umwelt hilfreich. Die Jesus-Tradition ist ein kontingentes Denk- und Verhaltens-Angebot, das durch nichts wirbt als durch sich selbst.
Daraus ergeben sich folgende nicht ganz einfache Fragen. Erstens:
Was heißt „Orientierung an der Jesus-Tradition“ in Relation zu einem traditionellen Verständnis von „Glaube an Jesus Christus“ etwa im Sinn der Zweinaturenlehre oder zu „Nachfolge Jesu“? Wenn sich darauf eine plausible und praktikable Antwort finden lässt, ist zweitens zu prüfen:
Wie kann und soll sich eine Gemeinschaft, die dieser Überzeugung folgt, mithin „Kirche“, angesichts der neuen Situation verstehen, formieren und präsentieren?
Dies impliziert Überlegungen, ob – und ggf. wie – die gegenwärtige Institution Kirche eine zukunftsfähige Gestalt ge-winnen kann, in der neben und mit den von der Tradition geprägten Mitgliedern auch Christen und Christinnen leben und wirken können, die ihrerseits traditionelle Auffassungen einer transzendenten Welt nicht zu teilen vermögen.
Dies wiederum führt zu einem dritten Problemkreis:
Wie kann die Jesus-Tradition einerseits mithilfe der Gemeinschaft der an Jesus sich Orientierenden, andererseits ohne die Umklammerung von institutioneller Kirche und traditioneller Religion für die Gesellschaft, ja für die Menschheit und den Kosmos fruchtbar werden?
Diesen drei Fragen möchte ich im Folgenden nachgehen. Unter der Perspektive einer sich auf die Immanenz redu-zierenden Weltsicht lauten die Stichworte dazu: Nachfolge Jesu ohne metaphysischen Überbau, barrierefreie Kirche, öffent-liche Theologie.
1. Nachfolge Jesu ohne metaphysischen Überbau
Wie kann Nachfolge Jesu ohne eine metaphysische Verankerung Jesu denkbar sein? Dagegen erheben sich mehrere Einwände: Der historische Jesus ist nicht greifbar. Jesus Christus ohne metaphysische Verankerung wird belanglos.
Sollte sich doch etwas wie Nachfolge in den Blick nehmen lassen, würde es sich auf Ethik begrenzen.
1.1. Jesus-Tradition
Das Problem der Historizität Jesu wird unterschiedlich beurteilt. Gerd Theißen und Annette Merz kommen zu einem eher positiven Urteil; andererseits jagt eine „quest“ nach dem historischen Jesus die andere. Das hat sogar zu der grundsätz-lichen Frage geführt, ob das Christentum an Jesus als einer historischen Gestalt festhalten muss. Wenn es dennoch ge-schieht, dann mit der Erwartung, dass der christliche Glaube keine selbst erfundene Fiktion darstellt. Doch wie auch immer man hier urteilt: Die Jesus-Tradition als solche ist vorhanden, und sie hat – bei aller Umstrittenheit – ihre eigene Ausstrahlung. Ernst Troeltsch fand sie gegeben im „Bild einer lebendigen, vielseitigen und zugleich erhebenden und stärkenden Persönlichkeit, deren innerste Lebensrichtung es in sich aufzunehmen gilt.“ [8] Ich würde hinzufügen, dass diese „Lebensrichtung“ sich beim Umgang mit den biblischen, insbesondere den neutestamentlichen Texten immer neu und vielfältig als fruchtbar darstellt und vermittelt. An diesen Quellen entspringt immer neu Jesus-Tradition, und dass es dabei zu Streit mit säkularen, nur psychologisch oder aus nichtchristlicher Perspektive urteilenden Betrachtungsweisen kommt, gehört mit zur Präsenz der Jesus-Tradition in der jeweiligen Gegenwart. Obgleich es sich in den Texten oftmals um Metaphern handelt, sind es doch Metaphern, darauf hat Markus Buntfuß hingewiesen, die zugleich bringen und „übertragen“ (daher ja der Begriff metaphora ), was sie ansagen. [9] So kommt es dazu, dass die Jesus-Tradition inspiriert und zu einer Lebenshaltung befähigt, die sich zusammenfassen lässt in der paulinischen Trias von Glaube, Liebe und Hoffnung. Glaube meint dabei nicht eine bestimmte Weltanschauung oder gar ein dogmatisiertes Weltverständnis, sondern ein nicht mehr detailliert adressierbares, weil abgrundtiefes Vertrauen. Liebe ist durch Geschichten des Neuen Testaments mannigfach illustriert. Hoffnung, Glaube und Liebe stützen sich gegenseitig, sofern sie einzeln immer wieder gefährdet und infrage gestellt sind. Damit gehört zur Jesus-Tradition nicht nur die Überlieferung von Sätzen, sondern auch ihre Realisierung, wie sie sich nämlich umgesetzt hat und im Lebensvollzug von Menschen erahnen lässt, die sich auf sie eingelassen haben. Diakonische Präsenz gehört von Anfang an zur christlichen Germeinde. Die Jesus-Tradition manifestiert sich in einem Vertrauen, wie es bei Luther oder Bonhoeffer begegnet, und in einer liebevollen Zugewandtheit zu Menschen und außermenschlicher Kreatur, wie sie sich spiegelt im Verhalten von Franz von Assisi oder Albert Schweitzer, und in den Utopien von Martin Luther King.
1.2. Jesus unter anderen
Klassische Christologie hebt Jesus als den Christus kategorial von anderen Menschen ab und versucht ihn doch zugleich als einen gewöhnlichen, „normalen“ Menschen zu verstehen. Dieser Versuch ist rational überzeugend nie gelungen, weswegen seine Unrealisierbarkeit bereits mit dem Dogma von Chalcedon festgeschrieben wurde. Das orthodoxe Insistieren auf dem vere Deus hat aber oft darüber hinweg getäuscht, dass es sich dabei nicht um eine metaphysische ontologische Feststellung, sondern um ein Bekenntnis handelt, das auf ein Erleben zu reagieren sucht, wobei dieses Erleben keineswegs als Einbruch von Transzendenz interpretiert werden muss. Offenbar haben Menschen mit Jesus – oder dem Bild, das sie von ihm hatten – Ungewöhnliches, Erschütterndes und auch Hilfreiches erlebt. Mit Jesus bzw.
mit jeweiliger Jesus-Tradition kann man Erfahrungen machen wie mit anderen Gestalten und Traditionen, die sich aber doch von diesen spezifisch unterscheiden. Jesus ist ein Mensch wie alle anderen Menschen und somit auch wie Buddha Shakyamuni, Muhammad oder Sokrates, und doch bleibt er dabei auch ein besonderer. Vielleicht gehört zu seinen Besonderheiten, dass er nicht nur einer unter anderen ist, sondern in gewisser Weise nach irdischen Maßstäben „unter“ ihnen steht in dem Sinn, dass er nicht in derselben Hinsicht weise war wie Buddha oder Sokrates und nicht durch-setzungsfähig wie Muhammad. Jesus wird als einer unter anderen keineswegs belanglos. Seine Relevanz berührt sich in manchem mit derjenigen von anderen Menschen, in manchem ist sie als spezifisch profiliert erkennbar. Sie berührt sich mit den Einsichten des Buddha über die egozentrierte Verfasstheit des Menschen und widerspricht zugleich der Vorstellung, man könne sie durch eigene Anstrengung überwinden. Sie unterstützt die Wahrnehmung der Würde des Menschen, wie sie schon in der jüdischen und später teilweise in der islamischen Tradition begegnet und wendet sich zugleich gegen alle unfrei machende Gesetzlichkeit, wo auch immer diese sich durchsetzen will.
1.3. Jesu Relevanz
Als ethisch relevant ist beispielsweise die Bergpredigt auch für Nichtglaubende unschwer zu erkennen. Je mehr ein hedonistisch-materialistisches Ethos um sich greift, desto deutlicher dürfte sich zeigen, dass eine Orientierung am christlichen Ethos der Menschheit gut bekäme. Im Blick auf manche Züge archaischer Religiosität oder auch der Scharia, die einem aufgeklärten, vom Christentum gespeisten Konzept von Menschenwürde widersprechen, ist die an der Jesustradition zu gewinnende Ethik mindestens höchst bedenkenswert.
Inwiefern wird es aber beim Versuch der Jesus-Nachfolge bei ethischer Orientierung allein nicht bleiben?
Indem Jesus zum orientierenden Vorbild wird, wird er zugleich zu einem inneren Gesprächspartner, ohne den auch areligiöse Menschen kaum durchs Leben kommen werden. Psychologen wie Gerald Hüther verweisen darauf. [10] Vor Jahrzehnten hat Dorothee Sölle sarkastisch behauptet, es mache doch wohl einen Unterschied, ob ich mich mit einer Gestalt wie Hitler in innerem Gespräch befinde oder etwa mit dem Jesus der Evangelien. Auch ohne dass es in der Beziehung zu ihm das direkte „Du“ gibt, hat diese, wie Eugen Drewermann ausführt, etwas Therapeutisches, Heilendes. Eugen Biser wählt das Bild der Freundschaft. [11] Die Gestalt Jesu wird zum lebensbegleitenden Du, das sich ohne metaphysischen Überbau – und ganz bestimmt nicht durch einen solchen! – vergegenwärtigt. Von daher sollte es auch dem areligiösen Menschen nachvollziehbar sein, dass der Pietist singt: „Ach, mein Herr Jesu, dein Nahesein / bringt großen Frieden ins Herz hinein (…).“ [12]
Das pietistische Du droht zur Droge zu werden, wenn es undialektisch bleibt und das Chaotische, innerhalb dessen sich Nachfolge vollzieht, nur verdrängt. Nähe Jesu heißt Nähe des Angefochtenen, von Gott Verlassenen, Gekreuzigten. Indem sich der Glaubende dem „christologischen Zustand“ (Urs von Balthasar) der dunklen Nacht der Passion nicht entzieht, wird ihm Jesus zum Christus, zu seinem „Ein und alles“, dem „el Todo“, wie ihn Johannes vom Kreuz beschrie-ben hat. [13] Transzendenz, wenn man es dann so nennen will, erscheint dem Glaubenden nicht von „außen“ oder „oben“, sondern von innen: So „lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir“ (Gal 2,20). Das „extra nos“ begegnet
„in nobis“. Eine persönliche Begegnung, wie wir Menschen unter einander sie erleben, kann es mit dem Jesus, der in die Nachfolge ruft, nicht geben. Aber der Christus, der in mir lebt, so lässt sich in Aufnahme und Umkehrung einer Formu-lierung von Rudolf Bultmann sagen, ist „jedem Du unseres heutigen Miteinanderseins überlegen“. [14] Von dieser inneren Gewissheit her, die sich unverfügbar, aber kontingent im Umgang mit der Jesus-Tradition einstellen kann, mögen sich dann auch traditionelle religiöse Vorstellungen erschließen, ohne dass es notwendig dazu kommen müsste. Von der christologischen Grunderfahrung aus ergibt sich ein neuer Blick auf Eigenes und Fremdes, auf Vergangenes und Künftiges, auf alle Horizonte und Facetten des Lebens. Eine ganze, voll ausgearbeitete trinitarisch argumentierende Dogmatik kann sich daran anschließen; aber das muss nicht sein: Jesus Christus „solo basta“. [15]
2. Kirche innerhalb und außerhalb der Institution
Wenn die Kirche die Verpflichtung spürt, ihre Botschaft nicht nur religiös sensiblen, sondern auch areligiösen Menschen nahe zu bringen, muss sie sich fragen, inwieweit sie sich selbst zu sehr an traditionelle religiöse Formen und dogma-tische Formeln bindet. Sie wird dabei möglicherweise ein neues und weiteres Verständnis ihrer selbst gewinnen. Wenn Nachfolge Jesu ohne metaphysische Vorgaben und insbesondere ohne die Voraussetzung eines theistischen Gottes-begriffs möglich ist, gilt es nun, zu überlegen, welche Konsequenzen sich für eine Kirche der Zukunft daraus ergeben.
Wie kann eine Kirche existieren, die prinzipiell ohne den metaphysischen Überbau traditioneller Ekklesiologie aus-kommt? In Zeiten der Gott-ist-tot Theologie sagte man: Gott ist tot, aber die Kirche lebt weiter. Das war nicht nur ironisch gemeint, sondern konnte als das Geheimnis der Kirche begriffen werden. Schon ein halbes Jahrhundert zuvor hatte Bonhoeffer die Formel geprägt „Christus als Gemeinde existierend“. Wie war und ist sie zu verstehen? Welche konkreten Implikationen enthält sie?
2.1. Die real existierende Kirche
Als Institution existiert und agiert die Kirche in vielfältigen Gestalten, ggf. auch ohne das schützende Dach gesellschaft-licher Anerkennung und weltanschaulicher Selbstverständlichkeit. Psychologische und soziologische Gesetze indivi-dueller und gesellschaftlicher Lethargie mögen dazu beitragen. Aber es vollzieht sich auch gewiss nicht unabhängig davon, dass das Evangelium nach wie vor Menschen findet, die ihm zustimmen, und ohne dass Abendmahl und Taufe praktiziert werden, weil dies als gut empfunden wird. Die Jesus-Tradition wird aufgenommen und weitergetragen, in Worten, in sakramentaler Repräsentation sowie in existenziellem und diakonischem Einsatz. Sie erlebt je nach Ort und Umständen Widerstand; nicht wenige, die sich in ihr engagieren, sind vom inneren und äußeren Zustand der Kirche als Institution frustriert. Aber an vielen Stellen der Welt ist sie da. Die Kirche muss sich nicht gründen, und sie ist nicht ohne Weiteres abzuschaffen.
Hinzu kommt, dass an vielen Stellen der Welt auch außerhalb von institutioneller Kirche etwas vom Geist Jesu beobacht-bar und spürbar ist. In zahlreichen NGO’s werden – ohne dogmatischen Überbau – Ziele verfolgt, die den Intentionen des Evangeliums entsprechen; man denke an Amnesty International, Greenpeace, Ärzte ohne Grenzen. Es dürfte kein Zufall sein, dass sie nahezu alle in christlich geprägten Ländern entstanden sind. Was hier an persönlichen Opfern ge-bracht wird, bis hin zum Einsatz des Lebens, stellt mitunter die offiziellen Kirchen und deren Mitglieder in den Schatten. Auch heute völlig säkulare Institutionen wie das Rote Kreuz – und in dessen Gefolge Roter Halbmond – oder die UNO mit ihren diversen Untergliederungen sind ohne christlichen Hintergrund kaum denkbar. Die Aufzählung ließe sich unschwer fortsetzen.
Damit stellt sich freilich die Frage nach dem Verhältnis von manifester und latenter Kirche, von verfasster und eigent-licher Kirche, von Gemeinschaft der Glaubenden und Präsenz Jesu Christi.
2.2. Christus als Gemeinde existierend
In Abwandlung eines Gedankens von Hegel, der vom Heiligen Geist „als Gemeinde existierend“ gesprochen hatte [16], prägt der junge Bonhoeffer die Wendung: „Christus als Gemeinde existierend“. Er verbindet diese Formel später mit dem neutestamentlichen Bild vom Leib Christi. Die Kirche ist ihm „die Gegenwart Christi“ [17], wie andererseits die Kirche das Mandat hat, „die Wirklichkeit Jesu Christi (…) wirklich werden zu lassen“. [18] Inwieweit er dabei auch an die verfasste Kirche denkt, mag hier offen bleiben. [19] Zu modifizieren ist jedenfalls der Begriff „existieren“. Ich habe vor Jahren als Modifikation der Bonhoefferschen Formel vorgeschlagen: „Christus als Gemeinde sich ereignend“. [20]
Eine Gemeinschaft kann im Grunde nicht „existieren“, sondern nur „sich ereignen“. Sie existiert, indem sie sich ereignet. Wie ereignet sich Christus als „Gemeinde“? Er ereignet sich, indem es zum Glauben, zur Nachfolge kommt. Wo „zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen“, da ist er, da ereignet er sich als Gemeinschaft. Beim gemeinsamen Gang nach Emmaus „brennt das Herz“ der Glaubenden. Wo über Jesu Leben, Lehre und Geschick nachgedacht wird, wo gemeinsam das Brot gebrochen wird, da ereignet sich Christus – in den Stichworten der Confessio Augustana gesagt:
Wo Gottes Wort verkündet und wo die Sakramente vollzogen werden und zur Auswirkung gelangen. Das große christliche Symbol von Gemeinschaft ist das Abendmahl, das der Integration in diese Gemeinschaft die Taufe. Nach Ansicht des jungen Luther ist das allgemeine, gegenseitige und gemeinsame Priestertum der Glaubenden das Grundkonzept christlicher Gemeinde: einer für den andern, alle für alle, einander Priester sein, für einander da sein,
von Bonhoeffer erweitert zu: gemeinsam Kirche für andere sein. Für den traditionell Sozialisierten und natürlich für Luther und für Bonhoeffer macht das nur Sinn im Rahmen des traditionell verstandenen christlichen Glaubensbekennt-nisses. Vollzieht sich in alledem aber Geist Jesu nicht auch, ohne dass man einen theistischen Gott voraussetzt? [21]
Kann die Frage nach Gott nicht offen bleiben, wenn nur erst einmal der Geist Jesu sich vollzieht, indem es zu spürbarem Vertrauen, aktiver Liebe und beflügelnder Hoffnung kommt?
2.3. Konkretionen
Wenn die Kirche diese Einsichten in Anspruch nimmt, wird sie ein neues Verhältnis zu den Menschen gewinnen, die ihr traditionell nicht verbunden sind. Zugleich wird sie in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen werden: nicht als eine gesellschaftliche Gruppe, die an einer überlebten und wissenschaftlich nicht haltbaren Weltanschauung festhält und zugleich um den Erhalt von Privilegien kämpft, sondern als eine Gemeinschaft, der anzugehören Freude macht. Sie wird dann vielleicht als eine Art NGO verstanden, die sich spezielle Ziele gesetzt hat, nämlich an den Rand gedrängten und benachteiligten Menschen zu helfen, ohne Macht und Einfluss für sich selbst gewinnen zu wollen. Sie wird nicht mit dem Anspruch auftreten, letzte Wahrheit zu präsentieren, um daher Beachtung und Respekt einfordern zu können. Sie wird vielmehr eine Lebensperspektive anbieten, die keine Übernahme abstruser Theorien fordert, sondern zu einem in sich plausiblen Lebensvollzug einlädt. Sie setzt nichts voraus außer der Orientierung an den Worten und dem Verhalten Jesu: Gutes tun den geringsten Brüdern und Schwestern, Frieden machen, hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, und hineinwachsen in die Haltung des Vertrauens auch angesichts von Enttäuschung, in eine Zugewandtheit zu allem,
was der Zuneigung und der Unterstützung bedarf, in eine Gewissheit der Hoffnung auch inmitten der Versuchung
zur Hoffnungslosigkeit.
Wie kann die Kirche eine solche Ausstrahlung gewinnen? Sie muss neu mit ihrem Bekenntnis umzugehen lernen. Das Bekenntnis muss entkonditionalisiert werden! Es darf nicht als implizite oder explizite Bedingung für die Mitgliedschaft in der Kirche zu stehen kommen. Das Apostolikum sollte daher auch aus dem permanenten liturgischen Gebrauch herausgenommen werden. Ein vorformuliertes Bekenntnis gehört in den geistlichen Austausch der Glaubenden unter einander, als Ausgangspunkt für das eigene Bekennen, als zeitlich begrenzte, auf den Moment zugeschnittene Standort-bestimmung, als dankbare Zusammenfassung dessen, was Glaubende erlebt haben und von daher mit einander teilen. Natürlich spielt auch das Moment der Abgrenzung eine Rolle, aber nicht von Menschen, sondern von Meinungen.
Sodann sollte es in einer Sprache formuliert werden, die auch von Menschen außerhalb der Kirche verstanden werden kann. Es braucht Übersetzungen, am besten in einen Aussage-Modus, der nicht weltanschaulich oder gar ontologisch formuliert, sondern der zu erkennen gibt, inwiefern das, was hier zur Sprache gebracht wird, aus Erfahrungen kommt und zu neuer eigener Erfahrung einlädt. Dies berührt natürlich das Problem sprachlicher Vermittlung überhaupt. Es genügt nicht, wenn die Kirche ihre traditionelle Sprache weiter verwendet und diese ein bisschen durch moderne oder sogar burschikose Wendungen aktualisiert. Sie muss vielmehr im Blick auf die unterschiedlichen Menschen, die sie ansprechen will, mehrsprachig werden. Mit ihrer religiösen Sprache kann sie sich auf ökumenischer und zum Teil auch auf interreligiöser Ebene noch bis zu einem gewissen Grad verständlich machen. Das funktioniert aber nicht mehr im Blick auf Agnostiker, Atheisten oder religiös völlig Desinteressierte. [22]
Entsprechendes gilt für Riten, insbesondere die Sakramente. Ich verdeutliche das am Beispiel „Abendmahl“. Das Abend-mahl wird in seiner derzeitigen liturgischen Form kaum als Symbol gelingender Gemeinschaft verstanden. Wer es hin-sichtlich dieser seiner Funktion ernst nimmt, kann es als Idee großartig finden. Der atheistische Philosoph Alain de Botton meint, man müsste es in gewisser Weise säkular nach-erfinden und ins Säkulare umsetzen; keinesfalls dürfe man es den Religiösen überlassen. [23] Im Blick auf das Abendmahl muss die Kirche differenziert zu denken lernen. Auf der einen Seite höre ich, dass das häufige Abendmahlsangebot die Zahl derer, die regelmäßig zum Gottesdienst kommen, senkt. Das Abendmahl kann vom Gottesdienstbesuch abhalten, woran auch immer das liegen mag. Andererseits gibt
es offenbar Menschen, die nicht zur Kirche gehören, dort aber Freunde haben, mit denen sie durchaus gern zum Abend-mahl gehen würden, aber von Rechts wegen dort nicht teilnehmen dürfen. Nach beiden Seiten hin müsste die Kirche flexibler werden und vor allem in ihrer Verkündigung stärker deutlich machen, was das Abendmahl über das Moment des Gemeinschaftlichen hinaus bedeutet.
Hier lassen sich Fragen zur diakonischen Existenz der Kirche und zu einem authentischen und effektiven Alltagschristen-tum ihrer Mitglieder anschließen.
Damit ist ein weiteres Problem angesprochen: das der Mitgliedschaft in der Kirche. In Deutschland ist das klar geregelt: Zur Kirche gehört, wer getauft ist und Kirchensteuer zahlt. Nach diesen Kriterien werden ggf. Arbeitsstellen in einer Ge-meinde vergeben. Das gibt für eine christliche Kirche ein trauriges Bild ab. Hier müssen neue Regeln gefunden werden. Weltweit gesehen „existiert Christus“, um die Bonhoeffersche Formulierung zu verwenden, nicht nur innerhalb der Grenzen organisierter Mitgliedschaft. Für die Kirche in Europa bedeutet das: Sie muss sich öffnen, barrierefrei werden. Wir brauchen Übergangszonen, Überschneidungszonen mit der Öffentlichkeit, in denen sich Sympathie mit der Kirche auch unter Außenstehenden einstellen kann, auch ohne dass sie gleich formell in eine Kirche eintreten bzw. um Aufnahme in den Tauf-Unterricht bitten.
3. Öffentliche Theologie
Zur Zeit der Reformation war der Begriff „öffentlich“ in der Kirche zuhause; er hat sogar Eingang in die Bekenntnis-schriften gefunden: Niemand in der Kirche soll „offentlich lehren oder predigen oder Sakrament reichen“ / „publice docere aut administrare sacramenta“ ohne ordnungsgemäßen Auftrag (CA XIV). Der Gottesdienst selbst war eine „öffentliches“ Ereignis. Inzwischen droht er zu einer Sektenveranstaltung abseits von jeder Öffentlichkeit zu werden.
Die katholische Kirche vermag das durch mediale und gesellschaftliche Präsenz bis zu einem gewissen Grad zu kom-pensieren. Auf evangelischer Seite sucht zur Zeit der Ruf nach öffentlicher Theologie gegenzusteuern. Im Blick auf ethische Probleme, die die Gesellschaft bewegen, scheint das am nächsten zu liegen. Nötig wäre es aber auch im Blick auf Fragen des Bekenntnisses, der Gestaltung von Kirche, christlicher Existenz überhaupt. Das Ergebnis könnte eine öffentliche Kirche sein, die gleichwohl nicht in der Öffentlichkeit aufgeht.
3.1. Die Ambivalenz öffentlicher Theologie
Mit Recht hat Bonhoeffer schon 1932 festgestellt, der Gottesdienst kenne „nur noch die Nöte des Kleinbürgers (…) Nöte der Wirtschaftsführer, der Intellektuellen, der Kirchenfernen, der Revolutionäre kommen bei ihr nicht vor (…).“ [24] Eine Kirche, die für andere da sein will, muss sich für die Öffentlichkeit interessieren, sich ihr zuwenden. Die EKD hat dies z.B. in Gestalt ihrer Denkschriften getan. Die katholische Kirche kann sich auf entsprechende päpstliche und kirchliche Ver-lautbarungen beziehen. Doch wird auch sogleich die Problematik einer so verstandenen öffentlichen Theologie deutlich: Schon in dem Begriff ist kaum zu überhören, dass die Kirche „mitreden“ möchte. Rasch zeigt sich der Zusammenhang von „helfen wollen“ und „herrschen wollen“. Ich halte es nicht für sinnvoll, davon auszugehen, dass die Zivilgesellschaft „aus gesellschaftlichen Gründen“ öffentliche Theologie „braucht“. [25] Auch mit dem Begriff „Orientierungswissen“ sollte man wohl vorsichtig umgehen. Die eigene Überzeugung ins Spiel zu bringen, ist zweifellos eine „demokratische Tu-gend“. Übernimmt sich die Kirche nicht, wenn sie sich vornimmt, „die verändernde Kraft des Reiches Gottes in der Gegenwart wirksam werden“ zu lassen? Sorgfältiger formuliert Frits de Lange, Professor für Ethik in Kampen, Nieder-lande: „The church has no right to clericalise the world. At the same time the church has a special and unique mission to preach Christ and be the part of the world where Christ is obeyed and concretely takes form amongst and in people.” Keine Klerikalisierung, sondern Christus-Nachfolge! Auf diese Weise sei die Kirche für Bonhoeffer “a means to realizing Christ’s transformative presence“ [26] geworden, ein Mittel, die transformative Gegenwart Christi zu vermitteln. Öffent-liche Theologie ist unzureichend bestimmt, wenn man sie nur als ethische Stimme im Kontext des politisch-gesellschaft-lichen Stimmengewirrs versteht. Es fällt auf, dass die verfasste Kirche bereit ist, sich auf die in ihr sich vollziehenden Mechanismen hin öffentlich soziologisch untersuchen zu lassen. Zu öffentlichen ethischen Fragen bildet sie sich unter Zuhilfenahme von Fachleuten ein Bild und ihr Urteil. Doch wie steht es mit dem Bekenntnis? Wie wäre es mit einer „öffentlichen Christologie“?
3.2. Öffentliche Christologie
Der Begriff „öffentliche Christologie“ löst wohl keine Ängste vor kirchlicher Übergriffigkeit aus. Öffentliche Rede vom Kreuz bedarf in einer Situation, in der die Kruzifixe aus Klassenzimmern verschwinden und in der Heranwachsende schon einmal danach fragen können, was das Pluszeichen auf dem Kirchturm bedeutet, des Mutes und der Begrün-dung. Öffentliche Theologie, die einem Christuszeugnis mit und ohne Religion entspräche und die mit einer Kirche rechnete, in der Christus sich ereignet in Gestalt ihres kommunikativen Daseins für andere, hätte ihren Bezug zur Gesellschaft darin, dass sie sich dogmatisch und ethisch in Frage stellen ließe. Sie lebte nicht einseitig „aktiv“, sondern „interaktiv“. Sie ließe sich auf die Fragwürdigkeit ihres Bekenntnisses ein. Sie wäre bereit, in der Auseinandersetzung
mit den gesellschaftlichen Gruppen und mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu prüfen, wie sie ihr Bekenntnis selbst verstehen und dann auch vermitteln kann. Geübt ist die gegenwärtige Kirche in gewisser Weise hinsichtlich der öku-menischen Wirklichkeit. Sie ist dabei, dasselbe im interreligiösen Dialog zu erlernen. Wenig Mut und daher auch wenig Erfahrung aber hat sie in Auseinandersetzung mit religiösem Indifferentismus, mit Areligiosität und Agnostizismus. Als Ansätze in der richtigen Richtung darf man wohl die Diskussion Joseph Ratzingers mit Jürgen Habermas oder die Leip-ziger Diskussionsveranstaltungen [27] mit atheistischen Partnern verstehen. Doch sollte es bei derartigen Unterneh-mungen nicht um den Schlagabtausch gehen, sondern um ein echtes Wahrnehmen des anderen in dessen Relevanz für ein tieferes Verstehen des eigenen Standortes. Dies würde bedeuten, Theologie und auch Christologie nicht für andere zu entwerfen, sondern im Hören auf andere, im Gespräch und in Auseinandersetzung mit ihnen Christologie neu zu denken und zu erfassen. Öffentliche Theologie würde dann nicht primär in ethischen Stellungnahmen erkennbar, sondern als eine öffentliche Suchbewegung. Ihre Ausstrahlung und ihr „Salzgehalt“ würden weniger in Papieren und Events liegen als in Lebens-Vollzügen, die zur Partizipation einladen. Medium und Ziel einer so verstandenen öffent-lichen Theologie wäre somit eine „öffentliche Kirche“.
3.3. Öffentliche Kirche
Juristisch gesehen ist die Kirche in Deutschland eine öffentlich rechtliche Angelegenheit. Sie ist durch vielfache insti-tutionelle und finanzielle Beziehungen mit der Öffentlichkeit verbunden. Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können darauf verweisen. Aber die Botschaft der Kirche ist damit keineswegs in der Öffentlichkeit präsent. Die Gottesdienste verkümmern zu Nischen-Veranstaltungen, an denen jemand, der nicht zur ortsansässigen Gruppe gehört, sich kaum teilzunehmen getraut. Leichter findet der religiös Distanzierte oder auch Interessierte noch zur Moschee, wenn er dorthin zum Tee eingeladen wird, als in den Gottesdienst, selbst wenn im Anschluss daran Kaffee angeboten wird. Gruppen, die sich einmal gefunden haben, öffnen sich nur ungern für neue Mitglieder. Man bevorzugt die Wärme der überschaubaren Gemeinschaft. Manche Gemeinden in der ehemaligen DDR, die vor 1989 außerhalb oder am Rande der Öffentlichkeit eine tapfere und lebendige Gemeinschaft dargestellt haben, fühlten sich der dann auf sie einstürmenden neuen gesellschaftlichen Situation nicht gewachsen. Sich nicht der Öffentlichkeit zu stellen, ist bequemer; es mag auch religiösen Menschen besonders nahe liegen.
Man kann natürlich auf Bereiche verweisen, in denen die Kirche auch öffentlich sichtbar wird, wobei ich weniger an triumphalistische Selbstdarstellungen vor allem der katholischen Kirche oder an die öffentliche Diskussion von Skan-dalen denke. Was auch immer sich an sachgemäßer Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit etwa in Akademien, an Universitäten oder an Kirchentagen zeigt, muss unterstützt werden. Auch scheinen Kasualien, insbesondere Bestat-tungen, noch eine gewisse Ausstrahlung auf die Öffentlichkeit zu haben. Doch ist deutlich, dass es für die Kirche und vor allem ihre Botschaft auch eine falsche Öffentlichkeit geben kann. Bonhoeffer hat bei allem Insistieren darauf, dass die Kirche sich als ganz zur Welt gehörig verstehen muss, gewusst, dass das „Arcanum“ nicht profaniert werden darf. Als eine solche Profanisierung empfinde ich es, wenn etwa das heilige Abendmahl / die Eucharistie im Fernsehen dargestellt wird, wenn in Großaufnahme erscheint, wie der Kommunizierende die Hostie entgegennimmt. Eine ähnliche Profa-nierung wäre eine Beicht-Szene. Hier wird der Eindruck erweckt, man könne von außen, als Zuschauer, ein Bild davon gewinnen, was Glaube ist und wie Kirche funktioniert.
Auf eine sachgemäße Weise dagegen ist Kirche öffentlich, wo sie ihre Existenz in Verkündigung, Diskussion und dia-konischem Engagement mit den Nöten und Freuden der Gesellschaft teilt. Den Begriff „sharing“ finde ich an dieser Stelle hilfreich. Auftrag der Kirche heute ist es, Pluralismus nicht „zu gestalten“, wie Wolfgang Huber an prominenter Stelle behauptet hat [28], sondern mit zu gestalten. Wenn Christen sich einbringen, ohne dominieren zu wollen, kann von hier aus eine Fährte zu dem Geheimnis führen, von dem die Kirche und ihre einzelnen Mitglieder leben: zu der Botschaft von Jesus Christus, dessen Nähe in seiner Gemeinde sich verwirklicht und dort auch erfahren wird.
Auf diese Weise könnte die Dynamik zwischen Arcanum und Öffentlichkeit sich neu entfalten und für traditionsge-bundene wie auch religiös desinteressierte Zeitgenossen zur Herausforderung werden. Leben auf den Spuren und im Geist Jesu, Orientierung an seinem Vertrauen und an der Liebe und der Hoffnung, die von ihm ausstrahlen, auch ohne metaphysischen Überbau, das führt zu einer Kirche, die für andere und mit anderen denkt und wirkt. Eine solche Kirche wird den Mut entwickeln nicht nur zuzugeben, sondern frei heraus zu verkündigen, dass es nicht auf sie selbst in ihrer institutionalisierten Form ankommt, sondern auf die Geisteskraft, die sie begründet. Man kann auch außerhalb der Institution, ja sogar ohne spezifische religiöse Voraussetzungen Christ oder Christin sein. Christen und Nichtchristen, Buddhisten und Muslime, Agnostiker und Atheisten werden sich einer Lebens-Perspektive konfrontiert sehen, die sich zwar in religiösen Vorstellungen und Riten präsentieren kann, aber davon nicht abhängt. Lebendiger christlicher Glaube führt über Kirchlichkeit und Unkirchlichkeit, Religiosität und Areligiosität hinaus. Er verdichtet sich zu einer Gewissheit, die freie, selbstbewusste und einsatzbereite Menschen zu generieren vermag.
Hans-Martin Barth
e-mail: barthh-m@staff.uni-marburg.de
Quelle: (Deutsches Pfarrerblatt 114 (2014), 687-692)
Fußnoten
[1] Mitgliedschafts-Untersuchung XXX
[2] Bertelsmann-Stiftung. Religionmonitor 2008, Gütersloh 2007.
[3] Franz M. Wuketits, Was Atheisten glauben, Gütersloh 2014.
[4] Bernulf Kanitscheider, Auf der Suche nach Sinn, Frankfurt a.M., Leipzig 1995.
[5] Dietrich Stollberg, Religion als Kunst. Nachdenken über Praktische Theologie und Ästhetik, Leipzig 2014.
[6] Peter Rosien, Die Gottesfälscher. Wie die Kirchen Gott verschleiern. Mit einem Plädoyer für eine religionsüber-greifende Mystik, Oberursel 2013; vgl. Gerhard Wimberger, Glauben ohne Christentum. Eine Vision, Marburg 2013.
[7] Hans-Martin Barth, Konfessionslos glücklich. Auf dem Weg zu einem religionstranszendenten Christsein, Gütersloh 2013.
[8] Ernst Troeltsch, Die Bedeutung der Geschichtlichkeit Jesu für den Glauben, in: F. Voigt (Hg.), Ernst Troeltsch Lesebuch, Tübingen 2003, 61-92; Zitat: 87.
[9] Markus Buntfuß, „Ungeheuere Zusammensetzung“. Christologie und Metaphorologie, in: Chr. Danz und M. Murrmann-Kahl (Hg.), Zwischen historischem Jesus und dogmatischem Christus, Tübingen 2010, 259-273.
[10] Gerald Hüther, Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. Die Macht der inneren Bilder. Biologie der Angst, Göttingen 3. Aufl. 2013.
[11] Eugen Biser, Das Antlitz Christi. Eine Christologie von innen, Düsseldorf 1999, bes. 36, 144. Neuerdings hat Jürgen Moltmann den Gedanken der Freundschaft aufgenommen; vgl. ders., Der lebendige Gott und die Fülle des Lebens. Auch ein Beitrag zur Atheismusdebatte unserer Zeit, Gütersloh 2014, 12-131.
[12] EKG (Ausgabe für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern), 485 (nicht mehr im EG).
[13] Manuel Schlögl, Mystik – Atheismus –Dunkle Nacht. Johannes vom Kreuz und Therese von Lisieux im Gespräch mit dem neuzeitlichen Atheismus, Regensburg 2013, 210-213.
[14] Rudolf Bultmann, Zur Frage der Christologie, in: ders., Glauben und Verstehen Bd. I, Tübingen 9 1993, 85-113; 96: „Wird Jesus so gesehen, daß sein Bußruf uns die sittliche Forderung zum Bewußtsein bringt (…), so ist ihm jedes Du unseres heutigen Miteinanderseins überlegen.“
[15] In Abwandlung des „Solo Dios basta“ von Teresa von Avila.
[16] GS V, 247 ÜÜÜ
[17] DBW 1, 258 (PC Vortrag) ÜÜÜ
[18] Ethik 53 (HM)
[19] Vgl. http://www.dietrich-bonhoeffer-verein.de/fileadmin/Dateien_dbv/131_00_Tagungsberichte/2013_FT_Erfurt/148_00_2013_FT_Erfurt_3Gemeinde__Kirche_und_Leib_Christi_IV.pdf (abgerufen 2.5.2014). In der Druckfassung werden besonders steile Aussagen zurückgenommen. Ebd. S. 10.
[20] Vgl. dazu Hans-Martin Barth, „Christus als Gemeinde existierend“. Erwägungen im Anschluss an eine ekklesiologische Formel Dietrich Bonhoeffers, in: Dem Wort gehorsam. Landesbischof D. Hermann Dietzfelbinger DD. Zum 65. Geburtstag, München 1973, 28-47.
[21] Karl Rahner versucht deutlich zu machen, dass „Gott nicht in das Welt-bild hineingehört“. Von ihm müsse „in einer qualitativ anderen Sage“ gesprochen werden. „Wahrheit Gottes und Bild der Welt sind zweierlei.“ Vgl. Karl Lehmann, Albert Raffelt, Karl Rahner Lesebuch, Freiburg i. Br. 2004, 131f.
[22] Eigene, natürlich nur vorläufige Versuche habe ich gewagt in: Konfessionslos glücklich (wie Anm. XXX), 172f, 181f.
[23] Alain de Botton, Religion für Atheisten. Vom Nutzen der Religion für das Leben, Frankfurt a. M. 2013, 39-51, 301.
[24] GS V, 233. Huntemann 251
[25] Nachgedacht: Thesen zur öffentlichen Theologie von Heinrich Bedford Strohm: http://www.bayern-evangelisch.de/www/glauben/gedanken-zum-reformationsfest-von-heinrich-bedford-strohm.php (abgerufen 2.5.2014).
[26] Frits de Lange, Against escapism. Dietrich Bonoeffer’s contribution to public theology, in: Len Hansen (ed.), Christian in Public. Aims, methodologies and issues in public theology, Stellenbosch: Sun Press 2007, 141-152.
[27] Vgl. Ute Gerhardt, Woran glaubt, wer nicht glaubt? Überlegungen zum Dialog mit Atheisten, in: Reinhard Hempelmann (Hg.), Dialog und Auseinandersetzung mit Atheisten und Humanisten, EZW-Texte 2016), 63-94, bes. 75-89.
[28] Die ökumenische Bedeutung der öffentlichen Theologie für Europa, in: Internatiomal Journal of Orthodox Theology 3 (2012), 51-64; Zitat: 64.